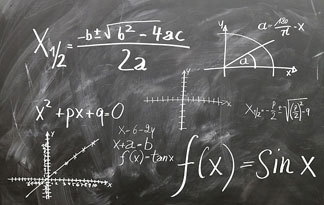Sole-Wasser-Wärmepumpe geplant?
Da sie die in der Erde vorhandene Energie umwandelt, wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe auch als Erdwärmepumpe bezeichnet. Sie funktioniert nach dem Prinzip eines umgekehrten Kühlschranks und entzieht dem Erdreich die Wärme, um sie für das Heizen nutzbar zu machen. Um die notwendige Temperatur zu erreichen, wird die Wärme in Verbindung mit einem Kältemittel unter Druck komprimiert. Im Erdreich muss - wie in Deutschland der Fall - ab 1,40 Metern eine Temperatur von über 0 Grad Celsius herrschen, aber nicht mehr.
Dadurch ist auch im Winter der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und Vorlauftemperatur der Heizung vergleichsweise gering. So erzielen Sole-Wasser-Wärmepumpen besonders hohe Wirkungsgrade: Aus einer Kilowattstunde Strom können bis zu 4,5 Kilowattstunden Heizenergie gewonnen werden. Für die Installation sind allerdings kostenintensive Bohrungen oder Erdarbeiten notwendig.
Verschiedene Bauarten zur Nutzung von Erdwärme
Insgesamt gibt es vier verschiedenen Bauarten der Sole-Wasser-Wärmepumpe, deren Realisierung teilweise auch von den baulichen Gegebenheiten Ihres Grundstücks abhängt. Doch egal, ob Sie sich für Erdsonde, Erdwärmekörbe, Erdwärmekollektoren oder einen Ringgrabenkollektor entscheiden: Das Grundprinzip bleibt gleich. Die oberflächennahe Geothermie wird zur Umwandlung in Heizenergie genutzt.
Der Unterschied zwischen den vier Varianten besteht vor allem in der Tiefe, aus der die regenerative Energie gewonnen wird - damit einher gehen auch Effizienz und Installationsaufwand. Um eine Erdsonde zu platzieren, muss z. B. in der Regel 10 bis 15 Meter tief gebohrt werden. Das verursacht zunächst hohe Kosten, langfristig ist diese Methode aber besonders effizient und wirksam.